



Hornissen sind beeindruckend: Sie sind bis zu 4 cm groß und Brummen laut. Auf viele Menschen wirken sie gefährlich. Kaum ein Insekt hat mit so vielen negativen Vorurteilen zu kämpfen wie die Hornissen.
Nur wenige wissen, wie nützlich Hornissen für den Menschen sind. Ein kleineres Hornissenvolk vertilgt pro Tag etwa ein ½ kg Insekten, u. a. Wespen, Fliegen und Mücken. Damit leisten sie einen wertvollen Beitrag zur biologischen Schädlingsbekämpfung.
Kuchen und süße Limonaden stehen nicht auf der Speisekarte von Hornissen. Daher werden Hornissen auch keine Kaffeetafel besuchen, das überlassen sie ihren kleineren Verwandten der Deutschen Wespe und der Gemeinen Wespe.
Auch die alte Mär „Drei Hornissenstiche töten einen Menschen, sieben ein Pferd“ sind schlichtweg falsch. Ihr Stich ist etwas schmerzhafter als ein Wespenstich, weil sie einen wesentlich größeren Stachel besitzen, aber nicht aufgrund des Gifts. Nur für Allergiker sind Hornissenstiche gefährlich.
Allerdings sind Hornissen sehr friedfertige Tiere, sodass selten Menschen gestochen werden. Die Tiere sind nicht gefährlich, wenn man sich richtig verhält.
Diese fünf Verhaltensregeln sollten beim Umgang mit Hornissen beachtet werden:
Hornissen besiedeln neben Baumhöhlungen auch Hohlräume in und an Häusern, z. B. Rollladenkästen, Dachböden und Zwischendecken. Im Sommer kann der Hornissenstaat auf mehrere hundert Tiere anwachsen. Das ist oft der Zeitpunkt, wann die Menschen auf ihre tierischen Untermieter aufmerksam werden. Da Hornissen gesetzlich besonders geschützt sind, ist es verboten, ihre Staaten ohne Ausnahme bzw. Befreiung von der unteren Naturschutzbehörde zu zerstören oder umzusiedeln. Die Ausnahme/Befreiung wird nur im Einzelfall, wenn triftige Gründe vorliegen, gewährt.
Befindet sich das Nest an einer kritischen Stellen, kontaktieren Sie daher bitte die untere Naturschutzbehörde des Ilm-Kreises: Ulrike Nüßler, 03628 738 676, u.nuessler@ilm-kreis.de.
In den meisten Fällen wird ein Vorort-Termin vereinbart, um zu prüfen, ob eine Umsiedlung oder Entfernung des Nestes notwendig ist. Wichtig: Die Ausnahme bzw. Befreiung der UNB ist kostenpflichtig. Auch die Kosten für die jeweilige Umsiedlung oder Beseitigung eines Hornissennestes sind vom Antragsteller bzw. von der Antragstellerin zu tragen.
Weiterführende Informationen zu Hornissen und Wespen
Webseite „www.aktion-wespenschutz.de“
Webseite „www.vespa-crabro.de“
Infoblatt der UNB Ilm-Kreis „Hornissen“, Stand 02/2020

Gemeinsam mit dem Naturkundemuseum Erfurt feiern wir an diesem Tag das Wappentier unserer Station, daher der Titel „Hirschkäferfest“.
Ab 15 Uhr können sich die Besucher auf spannende Exkursionen in der Umgebung der Burg freuen. Auf dem Burggelände selbst gibt es Wissenswertes zu den Projekten der Station und zum UNESCO Global Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen zu erfahren.
Stände mit regionalen Produkten, wie Schaffleisch und verschiedene Mitmachaktionen für Kinder runden das Angebot ab.
Kulinarisch locken das Kuchenbuffet, Säfte und Schorlen von der Streuobstwiese, eine regionale vegetarische Brotzeit und die Lammbratwurst vom Grill.
Dieses Jahr dreht sich alles um die Tiere der Nacht. Um 19 Uhr nimmt uns Dr. Christoph Unger mit in die Welt der „Greifvögel und Eulen“, bevor es um 21 Uhr auf zur Hirschkäfer- und Fledermausexkursion geht.
Anreise mit dem ÖPNV von Gotha Hbf. mit der Buslinie 870 Richtung Neudietendorf bis Freudentahl oder vom Bhf. Neudietendorf mit der Buslinie 870 Richtung Gotha bis Freudenthal und dann dem Wanderweg zur Burg folgen.
Mit dem Fahrrad von Neudietendorf aus auf dem Radweg „Thüringer Städtekette“ bis zum Freudenthal.
Parkmöglichkeiten auf dem Wanderparkplatz am „Freudenthal“ zwischen Mühlberg und Wandersleben.
Veranstalter:
Wir laden herzlich zur Exkursion im Schutzgebiet Kalkberg bei Arnstadt ein. Der Kalkberg beherbergt viele geschützte und selten Tier- und Pflanzenarten. Lernen Sie diese kennen und erfahren Sie, welche Maßnahmen zum langfristigen Erhalt und zur Entwicklung des Schutzgebietes geplant sind. Besonderen Schwerpunkt liegt auf dem ENL-Projekt Weidezaunbau, um die schonende Beweidung des Gebietes sicherzustellen.
Es lädt ein:
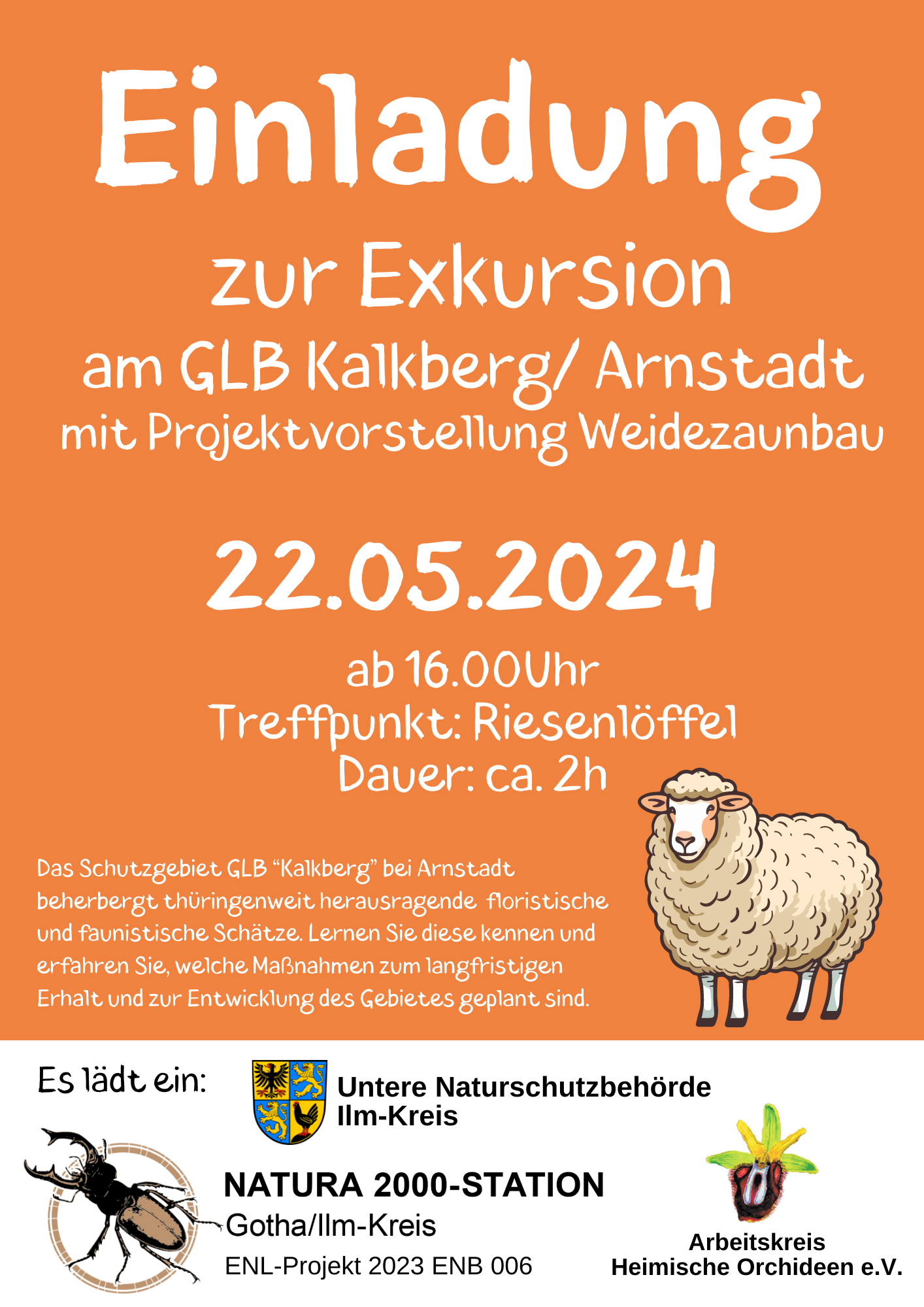
Es ist schon erstaunlich, dass unsere Mehl- und Rauchschwalben nach der langen Reise aus ihren Winterquartieren südlich der Sahara stets zielgenau zu ihren angestammten Brutplätzen zurückfinden. Als Nesttreue Vogelart geben sie das Nest des Vorjahres nicht auf, sondern bessern Beschädigungen aus und nutzen es erneut zur Jungenaufzucht. Circa 2.000 Lehmkügelchen sammelt und verbaut ein Schwalbenpaar für sein Nest und selbst stark beschädigte Nester werden mühevoll „restauriert“. Während Mehlschwalben ihre kunstvollen Nester unter Dachüberständen an Hauswände bauen, nutzen Rauchschwalben bevorzugt Nistplätze innerhalb von Gebäuden wie Stallungen, Scheunen und Garagen. Rauch und Mehlschwalben sind in den letzten Jahrzehnten immer seltener geworden. Infolge der zunehmenden Versiegelung gibt es immer weniger Lehmpfützen für den Nestbau. Weiterhin fehlt es an Insekten als Nahrung und geeigneten Nistplätzen. Ein großes Problem ist auch das Zerstören von Schwalbennestern bei Sanierungsarbeiten oder weil der Schwalbenkot stört. Egal ob es aus Unwissenheit oder mit Absicht geschieht: Das Zerstören oder Beschädigen von Schwalbennestern ist gesetzlich verboten. Unsere heimischen Schwalbenarten sind nach dem Bundesnaturschutz besonders geschützt. Es ist verboten, Schwalben nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Sie dürfen nicht erheblich gestört und ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten dürfen nicht aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden. Selbst wenn Nester unbewohnt scheinen oder nahezu unbrauchbar aussehen, dürfen diese nicht ohne Ausnahmegenehmigung oder Befreiung der unteren Naturschutzbehörde entfernt werden. Für die Beseitigung von Schwalbennestern müssen triftige Gründe vorliegen. Die Verschmutzung der Fassade durch Kot oder Nistmaterialstellt im Regelfall keinen Beseitigungsgrund dar! In den meisten Fällen lässt sich die Verschmutzung durch das Anbringen von sogenannten Kotbrettern, die mit einem Abstand von mindestens 40 Zentimetern unterhalb der Nester angebracht werden, verhindern.
Der Bestand unserer Schwalben ist den letzten Jahren stark zurückgegangen, umso mehr brauchen sie unseren Schutz. Sie können zum Bespiele helfen, indem Sie ihren Garten insektenfreundlich bewirtschaften, eine Lehmpfütze anlegen oder Kunstnester an geeigneten Standorten anbringen.
Wenn Sie Fragen zum Schutz von Schwalben haben, kontaktieren Sie bitte Ulrike Nüßler, untere Naturschutzbehörde, Telefon 03628/ 738 676, u.nuessler@ilm-kreis.de
Weitere Informationen:
ISSN 0946-1671 (idur.de): Der rechtliche Schutz von Schwalbennestern an Gebäuden (pdf-Dokument)

Wir laden herzlich zum Multimedia-Vortrag „Die Wiese lebt – Ausflug in den Mikrokosmos von Wiesen“ ein.
Wiesen prägen bis heute das Bild unserer Kulturlandschaft. Besonders bei einer extensiver Bewirtschaftung bieten sie im Jahresverlauf Lebensraum für unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten.
Der Naturfotograf Marko König hat über mehrere Jahre hinweg die Schönheit und Vielfalt von Wiesen in Bildern festgehalten. In seinen Porträts zeigt er, wie die verschiedenen Lebewesen in Beziehung stehen und voneinander abhängen. Dabei spannt er den Bogen von der spannenden, verborgenen Welt zwischen den Halmen und Stängeln bis hin zu den Tieren wie Fledermäuse und Neuntöter, die den Nahrungsreichtum der Wiese nutzen.
Mit diesem multimedialen Vortrag werden wir in diesem Jahr den 5. Naturschutztag zum Thema mehr Natur in Siedlungen ausklingen lassen.
Wann: 23.03.2024, um 15:00 Uhr im Rahmen des Naturschutztages
Veranstalter
Landratsamt Ilm-Kreis
Ritterstraße 14
99310 Arnstadt
www.ilm-kreis.de
Partner
TU Ilmenau
Ehrenbergstraße 29
98693 Ilmenau
www.tu-ilmenau.de
Veranstaltungsort
TU Ilmenau
Humboldtbau, Hörsaal
Gustav-Kirchhoff-Platz 1, 98693 Ilmenau
Informationen zur Anfahrt: https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/profil/campus-und-anfahrt
Kosten
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Anmeldung
Die Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht notwendig. Ihre Anmeldung richten Sie bitte an:
Landratsamt Ilm-Kreis
Untere Naturschutzbehörde
Ritterstraße 14
99310 Arnstadt
Telefon: 03628 738-661
Fax: 03628 738-664
E-Mail: umweltamt@ilm-kreis.de
Die Anmeldung kann telefonisch, per Post, Fax oder E-Mail erfolgen.
Datenschutzhinweis
Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei Teilnahme an Tagungen und Veranstaltungen des Umweltamtes: www.ilm-kreis.de/Ämter/Umweltamt/Downloads (unter Punkt „Sonstiges“)
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Naturschutzengagierte,
zum 5. Mal möchten wir Sie ganz herzlich zum Naturschutztag des Ilm-Kreises einladen. Diesmal liegt unser Fokus auf mehr Naturschutz und Artenvielfalt in Siedlungen. Auch möchten wir mit unserer Veranstaltung bereits bestehende Projekte in Dörfern und Städten vorstellen sowie Anregungen geben, wie mehr Natur in Siedlungsflächen erreicht werden kann. Der Naturschutztag bietet eine hervorragende Gelegenheit sich mit anderen Naturschutzinteressierten auszutauschen und neue Ideen zu sammeln.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und hoffe, dass Sie viele wertvolle Erkenntnisse gewinnen werden.
Herzlichst Ihre
Petra Enders
Landrätin im Ilm-Kreis
| 9:30 | Grußwort Petra Enders, Landrätin | |
| 9:45 | Grußwort Prof. Jens Müller, Vizepräsident für Internationale Beziehungen und Transfer der TU Ilmenau | |
| 10:00 | Naturschutzarbeit im Ilm-Kreis Andreas Mehm, Untere Naturschutzbehörde | |
| 10:15 | Naturschutzprojekte der Natura 2000-Station Gotha/Ilm-Kreis Claudia Müller, Natura 2000-Station Gotha/Ilm-Kreis | |
| 10:30 | Mehr Natur in Arnstadt N. N. , Stadtverwaltung Arnstadt | |
| 10:45 | BULB – Blühende und lebendige Betriebsgelände Susann Rostalski, Service Verband Gartenbau Thüringen e.V. | |
| 11:00 | Orchideen vor der Haustür Peter Rode, AHO Thüringen e. V. | |
| 11:45 bis 13:00 | Mittagspause | |
| 13:00 | Flurbereicherung für das Graue Langohr Christian Söder, Büro naturgeflatter | |
| 13:45 | Streuobstwiesen – wo Bäume und Wiese zusammen stehen Marie Scheller, Natura 2000-Station Gotha/Ilm-Kreis | |
| 14:30-15:00 | Kaffeepause | |
| 15:00 | Die Wiese lebt – Ausflug in den Mikrokosmos von Wiesen Marko König, www.koenig-naturfotografie.com | |
| 15:45 | Abschlussdiskussion |
Veranstalter
Landratsamt Ilm-Kreis
Ritterstraße 14
99310 Arnstadt
www.ilm-kreis.de
Partner
TU Ilmenau
Ehrenbergstraße 29
98693 Ilmenau
www.tu-ilmenau.de
Veranstaltungsort
TU Ilmenau
Humboldtbau, Hörsaal
Gustav-Kirchhoff-Platz 1, 98693 Ilmenau
Informationen zur Anfahrt: https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/profil/campus-und-anfahrt
Anmeldung
Landratsamt Ilm-Kreis
Untere Naturschutzbehörde
Ritterstraße 14
99310 Arnstadt
Telefon: 03628 738-661
Fax: 03628 738-664
E-Mail: umweltamt@ilm-kreis.de
Die Anmeldung kann telefonisch, per Post, Fax oder E-Mail erfolgen.
Anmeldefrist
15.03.2024, 9 Uhr
Kosten
Die Veranstaltung ist kostenlos. Speisen und Getränke auf Selbstkostenbasis.
Mittagsangebot
Zur Auswahl stehen:
Maria Streiferdt und ihr Team von der Keferküche gehören zu Thüringens Pionieren in Sachen Bio- Gastronomie / Catering. Alle Zutaten sind 100% Bio und es werden bevorzugt saisonale Produkte aus der Region verwendet. Weitere Informationen zur Keferküche unter www.keferkueche.de.
Das Mittagessen wird zu einem Preis von 15 Euro angeboten. Bitte beachten Sie, dass der Betrag am Tag der Veranstaltung in bar zu begleichen ist. Eine Kartenzahlung oder Überweisung im Vorfeld ist leider nicht möglich.
Bitte lassen Sie uns Ihre Entscheidung bis zum 15.03.2024 um 9:00 Uhr zukommen, damit wir die Gerichte entsprechend Ihrer Wahl vorbereiten können. Ihre Entscheidung richten Sie bitte an umweltamt@ilm-kreis.de
Datenschutzhinweis
Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei Teilnahme an Tagungen und Veranstaltungen des Umweltamtes: www.ilm-kreis.de/Ämter/Umweltamt/Downloads (unter Punkt „Sonstiges“)

Am 23.03.2024 findet an der TU Ilmenau der nächste Naturschutztag des Ilm-Kreises für alle Naturschutzengagierte und -interessierte statt. Die nunmehr 5. Auflage wird den Fokus auf mehr Natur in Dorf und Stadt richten. Der Ilm-Kreis hat in 2022 die Initiative „Ilm-Kreis blüht“ gestartet. Gemeinsam mit Kommunen, Privatleuten, Kirchgemeinden, Schulen und Vereinen haben wir viele Blühwiesen angelegt, Obstgehölze und Stauden gepflanzt. Damit konnten wir zusammen mehr Vielfalt und ein bisschen Wildnis in unsere Dörfer und Städte bringen. Zum 5. Naturschutztag möchten wir daran anknüpfen und für mehr Natur in unseren Dörfern und Städten werben sowie Bestrebungen und Projekte vorstellen, wie wir das erreichen können. Kommunen werden über ihre eigenen Anstrengungen für mehr Natur berichten. Wir möchten Beispiele von blühenden und lebendigen Betriebsgeländen vorstellen und zeigen, dass wildlebende, heimische Orchideen sich auch im Stadtgebiet beobachten lassen. Wir begleiten das Graue Langohr, einer seltenen Fledermausart, auf ihren nächtlichen Erkundungen und begeben uns mit den Streuobstwiesen in ein sehr artenreiches und wichtiges Bindeglied am Dorfrand.
„Die Wiese lebt – Ausflug in den Mikrokosmos von Wiesen“
Der multimediale Vortrag wird den Abschluss des Naturschutztages bilden. Der Natur-fotograf Marko König hat über mehrere Jahre hinweg die Schönheit und Vielfalt von Wiesen in Bildern festgehalten. In seinen Porträts zeigt er die Beziehungen zwischen den verschie-denen Lebewesen auf der Wiese und wie sie voneinander abhängen. Dabei spannt er den Bogen von der spannenden, verborgenen Welt zwischen den Halmen und Stängeln bis hin zu den Tieren wie Fledermäuse und Neuntöter, die den Nahrungsreichtum der Wiese nutzen.
Das ausführliche Programm wird in Kürze auf der Website des Ilm-Kreises (www.ilm-kreis.de) sowie der Webseite von Ilm-Kreis blüht (www.ilm-kreis-blueht.de) veröffentlicht und auf Wunsch auch per E-Mail versandt. Merken Sie sich den Termin vor – wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Der Veranstalter ist das Landratsamt Ilm-Kreis. Partner des diesjährigen Naturschutztages ist die TU Ilmenau.
Anmeldung bis 15.03.2024
Landratsamt Ilm-Kreis/ Untere Naturschutzbehörde
Ritterstraße 14
99310 Arnstadt
Telefon: 03628 738-661
Fax: 03628 738-664
E-Mail: umweltamt@ilm-kreis.de
Die Anmeldung kann telefonisch, per Post, Fax oder E-Mail erfolgen.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Speisen und Getränke auf Selbstkostenbasis.
Liebe Freundinnen und Freunde der wilden und bunten Wiesen,
das Jahr 2023 mit all seinen Herausforderungen neigt sich dem Ende zu und wir nehmen dies zum Anlass, um uns für die gute Zusammenarbeit bei Ihnen und Euch zu bedanken.
Gemeinsam konnten wir mit der Finanzierung über das Regionalbudget Nachhaltigkeit des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz von 2022 bis 2023 zahlreiche Maßnahmen umsetzen. Dazu zählen u. a. :
Es waren insgesamt 2,5 ha, die sich auf 35 Einzelflächen verteilten. Die Größe reichte von 60 bis 3000 m². Unter Projekte auf dieser Webseite wird ein Großteil der Projekte vorgestellt. Dies war nur Dank Ihrer und Eurer tatkräftigen Unterstützung möglich.
Besonderen Dank gilt auch unserem Projektpartner der Natura-2000-Station Gotha/Ilm-Kreis.
Wir freuen uns schon jetzt auf weitere gemeinsame Projekte, Gespräche und den Austausch im kommenden Jahr und wünschen:
Besinnliche Weihnachten, Zeit für Entspannung und einen guten Start in das neue Jahr 2024!
Herzliche Grüße
Die Mitarbeiter:innen der unteren Naturschutzbehörde
In manchen Regionen von Thüringen konnte man bis vor kurzem noch ein besonderes Naturschauspiel erleben – den Herbstzug der Kraniche. Leicht zu erkennen an ihren nasalen Trompetenrufen und der typischen V-Formation zogen unzählige Kraniche zu ihren Winterquartieren in Südwesteuropa und Nordafrika. Kraniche gehören, wie Mauersegler, Mehlschwalben, Weißstörche und einige weitere Arten zu den Zugvögeln, die den Winter in wärmeren Regionen verbringen und erst im Frühjahr zu ihren Brutplätzen zurückkehren.
Doch nicht alle Vögel ziehen davon, etliche bleiben hier und haben Strategien entwickelt, um die kalte und nahrungsarme Winterzeit zu überleben. Vögel sind gleichwarme Tieren, das heißt sie müssen ihre Körpertemperatur, die zwischen 38 und 42 Grad Celsius liegt, aufrechterhalten, um nicht zu erfrieren. Deshalb suchen sie zum Ausruhen und Schlafen ein geschütztes Plätzchen, je nach Vorliebe im Gebüsch, am Baum, in einer Baumhöhle oder auch in einem Nistkasten. Dort Plustern sie sich auf, so dass sie wie kleine Federnkugeln aussehen. Zwischen den gut aufgeplusterten Federn entstehen kleine Luftpolster, die isolierend wirken und vor dem Verlust der kostbaren Körperwärme schützen. Manche Vögel, wie der Zaunkönig, übernachten auch gern in Gruppen, um sich gegenseitig zu wärmen und so Energie zu sparen.
Fledermäuse, Siebenschläfer, Haselmäuse und Igel fressen sich im Spätsommer und Herbst, sofern es genug Nahrung gibt, eine dicke Speckschicht für den Winter an. Dann ziehen sie sich in gut geschützte und frostsichere Verstecke zurück, um Winterschlaf zu halten. Dafür werden alle Körperfunktionen auf ein Minimum reduziert: Der Herzschlaf verringert sich auf wenige Schläge in der Minute. Auch die Atmung ist kaum noch zu spüren und der Stoffwechsel kommt fast vollständig zum Erliegen. Ein Leben auf Sparflamme. In diesen Zustand können die Tiere allein von ihren Fettreserven zehrend mehrere Monate lang überleben. Nur gestört werden sollten sie nicht, da jedes Aufwachen lebenswichtige Energie verbraucht und zum Tod der Winterschläfer führen kann.
Andere Tiere, wie Eichhörnchen, Dachse und Biber verkriechen sich auch, fallen aber nicht in einen Winterschlaf. Sie halten Winterruhe. Dabei werden Herzschlag und Atmung merklich reduziert, aber nicht so stark wie bei winterschlafenden Tieren. Auch wachen die Tiere zwischendurch immer wieder auf, um zu fressen oder Stoffwechselprodukte auszuscheiden. Eichhörnchen und Biber legen sich zusätzlich oft noch einen Wintervorrat an, um über die karge Zeit zu kommen.
Säugetiere besitzen noch eine weitere Anpassung: Sie wechseln ihr Fell für den Winter. Das sogenannte Winterfell besitzt zahlreiche gekräuselte Wollhaare, die helfen Luftpolster am Körper zu bilden und so den raschen Wärmeverlust verhindern.
Einige Säuger halten weder eine Winterruhe noch Winterschlaf und müssen auf Nahrungssuche gehen. Besonders hart ist es für unsere Pflanzenfresser wie Reh, Rotwild, Hase und Kaninchen. Denn vor allem wenn eine Schnee- oder Eisschicht das Land überzieht, ist frisches Grün selten. In diesen Zeiten wird vermehrt an frischer Rinde und Knospen geknabbert. Doch je kälter es wird, desto weniger bewegt sich beispielsweise das Rotwild. Zudem schrumpfen die Verdauungsorgane des Rotwilds im Winter erheblich.
Dank der geschrumpften Organe sparen die Tiere einiges an Energie ein und können trotz geringeren Nahrungsangebot überleben.
Wechselwarme Tiere, wie Reptilien, Amphibien und Insekten verfallen bei sinkenden Temperaturen in eine sogenannte Kältestarre. Diese ähnelt dem Winterschlaf, so sinken Herzschlag und Atemfrequenz stark ab. In der Winterstarre können die Tiere auch Temperaturen unter null Grad Celsius überleben. Ihr Geheimnis: Sie lagern vermehrt Glukose in ihren Körperflüssigkeiten ein. Die Erhöhung der Glukosekonzentration wirkt wie ein Frostschutzmittel und verhindert das Einfrieren der Körperflüssigkeiten. Aus ihrer Starre erwachen die Tiere jedoch erst wieder, wenn es draußen wärmer wird und der Frühling zurückkehrt.
Alle Anpassungen zielen darauf ab, möglichst viel Energie zu sparen. Dies ist für unsere Wildtiere überlebenswichtig.
Sie können helfen, indem Sie bei Ihren Winterspaziergängen umsichtig sind, ihren Hund anleinen und keine Tiere, wie Rehe, Vögel, etc. aufschrecken.
Lassen Sie im Garten alle Laub-, Ast- und Komposthaufen bis zum Frühjahr in Ruhe, damit nicht versehentlich z. B. ein Igel aus dem Winterschlaf gerissen wird. Nistkästen bitte auch erst im Frühjahr reinigen, um nicht eine Haselmaus oder Siebenschläfer zu wecken. Des Weiteren können Sie auch einige Vögel, wie Blaumeisen, Amseln, Rotkehlchen und Spatzen, durch eine Winterfütterung unterstützen. Auch das Belassen von Früchten und Samenständen im Garten hilft den Tieren.
NABU: Tipps zur Winterfütterung
Wildvogelhilfe: Winterfütterung
